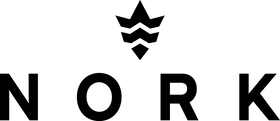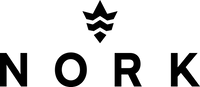· Von Luka Kastens
Korn Herstellung
Korn, Doppelkorn und Co: Da denken die meisten wohl erstmal nur an verstaubte Spirituosen-Schränke, an denen sich in der Jugend heimlich bedient wurde – und den ersten Kater am nächsten Morgen. Tatsächlich steckt aber viel mehr hinter der urdeutschen Spirituose: Die Herstellung von Korn ist nämlich eine traditionsreiche Sache. Ihr habt euch gefragt, wie dieses Volksgetränk überhaupt hergestellt wird? Wir erfüllen an dieser Stelle unseren (nicht vorhandenen) Bildungsauftrag und tauchen ein in die Welt des Korns, damit ihr versteht, wo unser milder NORK Original und unser aromatischer NORK Derbe überhaupt herkommen.
Die Grundlage der Korn Herstellung: Das steckt hinter der Getreidespirituose
Korn ist eine der traditionsreichsten Spirituosen in Deutschland und wie sich vom Namen herleiten lässt, wird Korn aus Getreide gebrannt. Dabei sind ausschließlich Roggen, Weizen, Gerste und Hafer als Sorten zugelassen, wobei Weizen und Roggen die beliebtesten Optionen sind. Echter Korn ist zudem frei von jeglichem Schnickschnack, wodurch er je nach Getreidesorte und Weiterverarbeitung einen reinen, milden bis kräftigen Geschmack erhält. Der Alkoholgehalt beträgt mindestens 32 % und bei Doppelkorn 38 %.
Historisches
Wir beginnen unsere Zeitreise im Mittelalter, als Korn erstmals als “gebranntes Wasser” im Jahre 1507 in der Stadt Nordhausen in Thüringen erwähnt wurde. Schon damals war der Kornbrand so begehrt, dass in der gleichen Gegend bereits Mitte des 16. Jahrhunderts ein Kornbrandverbot verhängt wurde – vermutlich als Protest der Bierbrauer und Bäcker im Streit um das Getreide. Doch das Verbot hielt nicht lange an, denn Mitte des 17. Jahrhunderts erlebte der Korn eine steile Karriere als das bevorzugte Getränk der gesellschaftlichen Oberschicht. Im Jahre 1789 wurde sogar das erste Reinheitsgebot für Kornbrand erlassen, das besagt, dass mindestens zwei Drittel Roggen und maximal ein Drittel Gerste verwendet werden dürfen und nur Wasser beigemischt werden darf.
Im 19. Jahrhundert vergrößerte sich zwar der Absatzmarkt für Korn, aber viele Kartoffelbrennereien machten dem Korn mit günstigeren Produkten dennoch das Leben schwer. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte durch die beiden Weltkriege und die damit verbundene Knappheit an Getreide und Kupfer den Ruin für die Destillen. In den 1960ern erlebte der Korn erneut einen Boom, sodass die Kornbrennereien mit ihrer Produktion kaum hinterher kamen – er wurde zum „Volksschnaps“ unter den Getränken. Dies hielt jedoch nicht lange an, denn in den folgenden Jahrzehnten flachte die Beliebtheitskurve des Korns aus nicht eindeutig nachvollziehbaren Gründen erneut ab. Trotz der vielen Höhen und Tiefen in seiner Geschichte hat sich der Korn zu einem zeitlosen und kultigen Getränk entwickelt, das heute die Herzen aller Altersgruppen im Sturm erobert. Natürlich auch dank unserer Mission: der Ehrenrettung des Korns!
So wird die deutsche Spirituose hergestellt
Obwohl das Reinheitsgebot von 1789 immer noch in Kraft ist, wurde es seitdem leicht modifiziert. Gemäß der „Verordnung über bestimmte alkoholische Getränke (AGeV)" des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, die in die Spirituosenverordnung der EU von 2008 aufgenommen wurde, darf Korn nur aus Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Buchweizen hergestellt werden, um als solcher bezeichnet zu werden. Es ist auch festgelegt, dass Korn keine Aroma- oder andere Zusatzstoffe enthalten darf.
Die Kornherstellung ist ein faszinierendes Handwerk, das sowohl Sorgfalt als auch umfangreiches Wissen erfordert. Der Prozess beginnt mit der Auswahl des Getreides, die die Grundlage für den Geschmack und die Qualität des Endprodukts bildet – Weizenkorn ist beispielsweise eher mild, während Roggen etwas intensiver schmeckt. Dann wird das Korn in einer Schrotmühle gemahlen und mit Wasser vermischt, um die Maische zu bilden. Nach Zugabe von Malz wird Stärke in Zucker umgewandelt. Die so entstandene Süßmaische wird dann mit Hefe versetzt, um den Zucker in Alkohol umzuwandeln. Der nächste Schritt ist die Destillation, bei der der Alkohol von den restlichen Bestandteilen der Maische getrennt wird, um störende Geruchs- und Geschmacksstoffe herauszufiltern. Dieser Prozess erfordert präzise Temperaturen, um Methanol im Vorlauf und unerwünschte Stoffe im Nachlauf zu entfernen und kann mehrfach wiederholt werden, um die Reinheit und Stärke des Korns zu erhöhen. Abschließend wird der Feinbrand mit Quellwasser, Gletschereis oder Eiswasser verdünnt. Schließlich wird der Korn in Edelstahltanks oder traditionellen Holzfässern gelagert, um ihm Zeit zur Reifung zu geben, während derer er sein volles Aroma entwickelt und milder wird.
Wie trinkt man Korn?
Ein weit verbreitetes Vorurteil ist: Korn wird ausschließlich pur, eiskalt und in einem Zug geleert – das ist vermutlich auch die Art, wie jeder Korn kennengelernt hat. Diese „Methode“ empfiehlt sich für eine Menge Billigkorn – aber es gibt ja auch Alternativen. Ein hochwertiger Korn (wir haben zufällig welche im Sortiment) können sehr wohl bei Zimmertemperatur und in mehreren Zügen genossen werden. Erst so kann guter Korn sein Aroma optimal entfalten. Natürlich kannst du Korn auch für Longdrinks und Cocktails verwenden. Grundsätzlich gilt, jeder Vodka Drink kann eins zu eins mit Korn gemacht werden. Check unbedingt aber auch unsere Rezepte (Verlinkung Rezepte-Seite) aus – dort wirst du garantiert deinen neuen Lieblingsdrink finden. Leckere Beispiele sind der Derbe Paloma und der Kornetto.
Beim klassischen Herrengedeck wird ein Bier zum Kornbrand gereicht – starke Kombi! Für die richtigen Genießer empfehlen wir das Herrengedeck 2.0 - kombiniert mal spannenden Craft Biere Mit aromatischen Körnern! Pairing ist das Schlagwort. Letztendlich liegt es ganz bei dir, wie du deinen Korn (aka NORK) genießt – CHEERS!